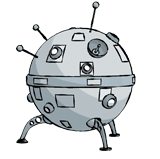Die Inquisition Bedeutung: einfach erklärt!
Wenn es um die Einheit des Glaubens und die Verteidigung der Kirche ging, kannten die Inquisitoren keine Gnade. Über viele Jahrhunderte wurden Häretiker, also Andersdenkende und -gläubige, von der Kirche bekämpft.
Wie kam es zur Inquisition?
Nachdem sich seit dem 12. Jahrhundert immer mehr Menschen von der Kirche abwandten und religiösen Gegenbewegungen anschlossen (Katharer und Waldenser), suchte die Kirche einen Weg, wie sie hier gegensteuern könnte. Die Bischöfe, die urspünglich für die Ketzerverfolgung zuständig waren, waren oft überfordert oder hatten gar kein Interesse.
Franziskaner und Dominikaner wurden zu Beauftragten der Inquisition
Deshalb griff der Papst auf Sondergesandte zurück, die sich nur der Inquisition widmen sollten. Die Grundlage für die Inquisition hatte schon Papst Innozenz III. gelegt. Diese sollte sich in erster Linie gegen Missstände in der Kirche richten. Inquisition bedeutet ursprünglich nichts anderes als "Erforschung". Geeignet schienen hier vor allem die Bettelorden der Franziskaner und der Dominikaner, da diese sehr viel Kontakt auch zum Volk besaßen, durch das Land wanderten und sich nicht nur hinter Klostermauern zurückgezogen hatten.
Beginn der Inquisition
Unter Papst Gregor IX. wurden die Dominikaner und Franziskaner mit der Ketzerverfolgung beauftragt. Damit begann quasi offiziell die "Inquisition". Die früheren Gottesurteile wurden abgelöst und der Inquisitor wurde mit besonderen Vollmachten des Papstes ausgestattet. Ein Inquisitor wurde immer tätig, wenn man glaubte, ihn einsetzen zu müssen. In der Regel wurde er vom örtlichen Bischof angefordert und an den Ort der vermuteten Hexerei oder Ketzerei geschickt. Ein ständiges "Inquisitionsgericht" gab es allerdings nicht.
Die Folter wurde erlaubt
Mitte des 13. Jahrhunderts wurde auch die Folter erlaubt, die, sollte die "Erforschung" ins Stocken kommen, sprich der und die Angeklagte nicht gestehen, eingesetzt werden durfte. Am Ende stand immer ein Urteil. Doch die Kirche selbst war ja nicht befugt, Urteile zu sprechen, so musste man die weltliche Macht hinzuziehen. Erst diese Unterstützung verhalf der Inquisition auf Dauer zu ihrem "Erfolg".
Nachdem die Kirche durch die Zusage von Kaiser Friedrich II. schon durch die weltliche Macht bei der Ketzerverfolgung unterstützt wurde, konnte sich die Inquisition in ganz Europa ausbreiten. Besonders in Frankreich, in Italien und in Spanien wurden viele Menschen Opfer der Inquisition. Ein bekannter Inquisitor ist zum Beispiel Bernhard Gui (geb. 1261 bis 1313) gewesen, der auch im Roman von Umberto Eco "Der Name der Rose" als Inquisitor auftaucht.
Wie ging ein Inquisitor vor?
Die Inquisitoren zogen von Ort zu Ort und Stadt zu Stadt. Trafen sie an einem bestimmten Ort ein, so hatten sich die Menschen auf dem Marktplatz zu versammeln. Der Bischof wurde allerdings zuvor in Kenntnis gesetzt. Wer sich selbst als Ketzer bezichtigte, kam mit Glück frei. Wurde er jedoch von jemand anderem angezeigt, schwanden seine Chancen, sich verteidigen zu können. Seit 1252 wurde zur Wahrheitsfindung die Folter eingesetzt. Die Folter war aber noch kein Urteil bzw. Strafe, sondern diente allein dem "Aufspüren der Wahrheit".
Viele gestanden unter Androhung der Folter
Die "Tortur" oder "peinliche Befragung" verlief in mehreren Stufen: Viele Verdächtige gaben schon auf, wenn ihnen die Folterwerkzeuge gezeigt wurden. Dann wurden härtere Methoden angewendet wie Daumen- und Beinschrauben. Auch kam die Streckbank als Folterwerkzeug häufig zum Einsatz. Wer jetzt gestand, hatte allerdings in den seltensten Fällen mit Milde zu rechnen. Die Strafen waren unterschiedlich und richteten sich nach der Schwere des Vergehens. Exkommunikation, also der Ausschluss aus der Kirchengemeinschaft oder auch die Auflage, ein Büßergewand anzuziehen, waren milde Strafen. Wer sich mit seiner Meinung allerdings gegen die gängige Kirchenmeinung stellte, der konnte auch mit dem Tod bestraft werden. Dann wartete häufig der Feuertod auf den Verurteilten, d.h. die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen.
Im Mittelalter ging die Inquisition in erster Linie gegen Ketzer vor. Es gab auch schon erste Hexenprozesse, aber der Höhepunkt der schlimmen Hexenverfolgungen fällt in in eine spätere Zeit und reichte bis weit in die Neuzeit hinein. Doch auch im Spätmittelalter nahm sich der Inquisitor schon Frauen vor, die jemand der "Hexerei" bezichtigte. In Lucys Wissensbox "Aberglaube und Hexerei" kannst du noch mehr darüber lesen.
Das Urteil wurde allerdings nicht durch den Inquisitor selbst, sondern durch die jeweilige weltliche Macht vollstreckt.