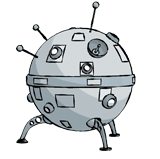Aberglaube im Mittelalter
Im Mittelalter glaubten die Menschen an viele übernatürliche Kräfte und Zeichen. Da Naturwissenschaften noch nicht weit entwickelt waren, suchten sie Erklärungen für Krankheiten, Naturkatastrophen oder Unglücke oft im Übernatürlichen.
Noch im Frühmittelalter verehrten die Menschen viele verschiedene Götter. Das Christentum breitete sich zwar durch die Mönche immer weiter aus, aber die Bewohner des Frankenreiches hatten mehrere Religionen gleichzeitig und glaubten an Dämonen, Geister und Naturgötter. Obwohl sich viele Menschen taufen ließen, bestanden die alten Vorstellungen und Bräuche oft lange Zeit weiter. Viele wurden auch zur christlichen Taufe gezwungen und waren keineswegs vom neuen Glauben überzeugt.
Was ist Aberglaube?
Aberglaube bedeutet, dass Menschen an übernatürliche Kräfte, Glücksbringer oder böse Omen glauben. Im Mittelalter vermischte sich der Aberglauben oft mit dem christlichen Glauben.
Der Glaube an Hexen und Zauberer wurde als "Aberglaube" verstanden
Die Kirche verbot den heidnischen Glauben, so nannte man den Glauben an Hexen und Zauberer, als Aberglaube. Wer von Hexen und Zauberern sprach, musste nach Meinung der Kirche Buße tun.
Konkrete Beispiele für mittelalterlichen Aberglauben:
Hexen & Dämonen: Man glaubte, dass Hexen mit dem Teufel im Bunde standen und Krankheiten oder Missernten verursachen konnten.
Mond & Sterne: Die Stellung der Sterne sollte das Schicksal der Menschen beeinflussen. Astrologie war sehr beliebt.
Böser Blick: Man glaubte, dass bestimmte Menschen oder Tiere mit einem Blick Unglück bringen konnten.
Amulette & Talismane: Viele Menschen trugen Glücksbringer wie Hufeisen, Kreuze oder magische Symbole, um sich vor Unglück zu schützen.
Schwarze Katzen: Sie galten als Zeichen des Teufels und wurden mit Hexen in Verbindung gebracht.
Blut & Heilkräfte: Man dachte, dass das Blut von Tieren oder Heiligen besondere Heilkräfte habe.
Für das Alltagsleben hatte der Aberglaube in vielen Bereichen Folgen.
Ende des Aberglaubens?
Daran änderte sich erst im Spätmittelalter etwas. In dieser Zeit begann die Kritik an den Missständen innerhalb der Kirche immer heftiger zu werden. Die Kirche missbrauchte ihren Einfluss, ihre Bischöfe lebten in Luxus und Reichtum und die Macht der Kirche wuchs genauso wie ihr Einfluss auf weltliche Dinge. Doch auch die Zahl der Kritiker an der Kirche wuchs immer weiter.
So war es einfacher für die Kirche, ihre unliebsamen Kritiker auszuschalten als sich mit der berechtigten Kritik auseinanderzusetzen. Wer die Kirche kritisierte, riskierte, als< bezeichnet werden. Wer von der Kirche abfiel, musste vom Teufel verführt sein. Plötzlich war der Glaube an Teufel und Hexer wieder da, den die Kirche lange Zeit selbst heftig bekämpft hatte.
Erst während der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, als die Wissenschaft Erklärungen für bestimmte Ereignisse in der Natur fanden, konnte der Aberglaube zurückgedrängt werden. Doch auch heute gibt es noch so etwas wie Aberglauben. So ist Freitag, der 13. für viele Menschen ein Unglückstag sowie die Zahl 13 eine Unglückszahl.
Der Hexenglaube und seine schlimmen Folgen

Dieser Glaube ging so weit, dass man dachte, die Hexen und Zauberer flögen auf Besen oder Tieren durch die Luft, um gemeinsam den "Hexensabbat" zu feiern. Das war angeblich ein Fest der Hexen und Zauberer, das regelmäßig an geheimen Orten stattfand, so z.B. zur so genannten Walpurgisnacht, auf dem Brocken im Harz. Der Teufel höchstpersönlich sollte bei diesem Fest anwesend sein.
Und nicht nur das einfache Volk glaubte dies, auch durchaus gelehrte Menschen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit hingen solchen Vorstellungen an. Man könnte darüber lachen, hätte es nicht so schreckliche Folgen für viele Menschen - vor allem für viele Frauen - mit sich gebracht.