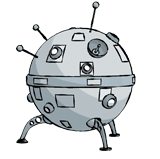Uhren wie wir sie heute kennen, waren den Menschen im frühen Mittelalter unbekannt. Ihr Tagesablauf wurde von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und von den Jahreszeiten bestimmt.
Ein Leben ohne Uhren?
Die Zeit wurde eigentlich noch gar nicht so richtig gemessen, jedenfalls nicht so wie heute. Das Leben der Menschen hing sehr eng mit der Natur zusammen. Die Zeit konnte man noch so gar nicht richtig erfassen und man richtete seinen Tagesablauf nach dem Stand der Sonne aus. Auch die Jahreszeiten waren sehr wichtig, denn im Winter gab es meist weniger zu tun, weil die Feldarbeit ruhte.
Ein Leben ohne Uhren?

Arbeiten, solange es hell war
Sobald sich die Sonne am Himmel zeigte, standen die Menschen auf und begannen mit ihrer Arbeit. Und sie hörten nicht auf, bis die Sonne wieder am Horizont verschwand. Es gab ja noch kein elektrisches Licht und Kerzen waren teuer und selten. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nachts sehr dunkel war, wenn nirgends ein Licht brannte. Arbeiten war dann nicht mehr möglich.
Wenn ihr das selbst mal ausprobieren wollt, wie so ein Leben ohne Licht sein kann, dann guckt doch in unser Mittelalter-Dunkelexperiment. Ihr findet es in den Machmit-Tipps.
Die Menschen im Frühmittelalter hatten also im Sommer viel mehr zu tun und viel längere Arbeitstage als im Winter. Die Tageszeit bestimmten sie, indem sie sich den Stand der Sonne am Himmel ansahen. Im späteren Mittelalter gab es dann die Kirchenglocken, die läuteten, das war dann eine weitere Orientierungsmöglichkeit.
Warum war für die Mönche die Zeit wichtig?
Bei den Mönchen gab es einen genauen Tagesplan, der unbedingt eingehalten werden musste. Die Mönche hatten feste Gebetszeiten, zu denen sie zusammenkamen.
So spielte die Kirche bei der Zeitmessung eine sehr wichtige Rolle. Im Mittelpunkt stand hier das so genannte Stundengebet der Mönche, das sich Horarium nannte. Dieses teilte den Tag noch einmal in verschiedene Abschnitte:
- Matutin (Nachtgebet, oft um Mitternacht)
- Laudes (Morgengebet bei Sonnenaufgang)
- Prim, Terz, Sext, Non (Stunden tagsüber, etwa alle drei Stunden)
- Vesper (Abendgebet)
- Komplet (Nachtgebet vor dem Schlafen)
Sie verwendeten für die Zeitmessung zum Beispiel Kerzen, die nach einer bestimmten Zeit erloschen. In Klöstern oder Burgen wurden Kerzen- oder Öluhren genutzt: Eine Kerze mit Markierungen oder ein Ölbehälter konnte die verstrichene Zeit anzeigen, war aber nicht sehr genau. Aber auch Sonnen- oder Wasseruhren kamen zum Einsatz. Diese waren zwar nicht sehr genau, boten zumindest eine gewisse Orientierung.
Auf dem Foto siehst du die Übergabe einer Wasseruhr an Karl den Großen. Wasser- und Sonnenuhren waren im Orient schon sehr viel länger bekannt. Schon die Menschen im alten Ägypten und in Mesopotamien haben Wasseruhren und auch Sonnenuhren zur Zeitmessung eingesetzt.
Zusammenfassung: Zeitmessung im Frühmittelalter
Die Zeitmessung im Frühmittelalter war ungenau und stark an das tägliche Leben, die Natur und die Kirche gebunden. Erst mit der Einführung von mechanischen Uhren im Hoch- und Spätmittelalter wurde die Zeitmessung genauer.